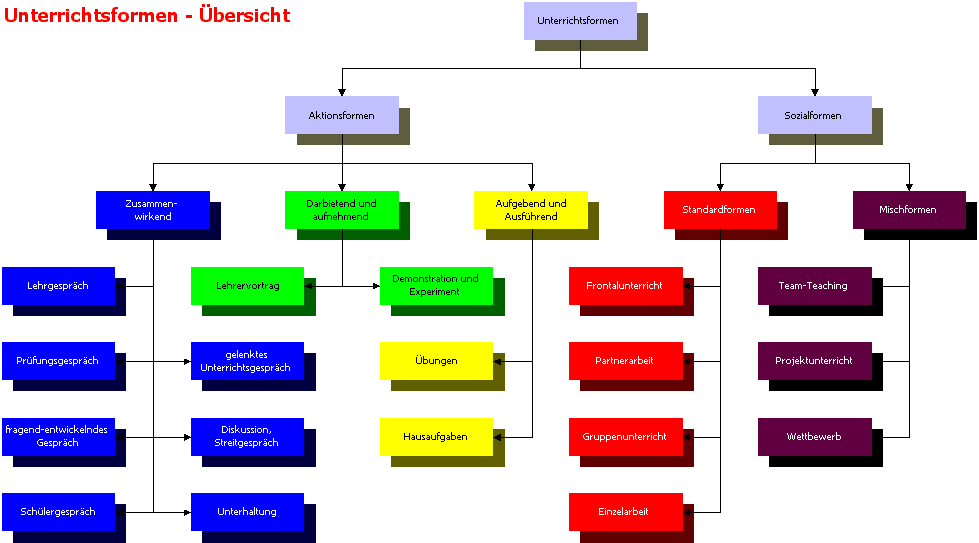
- übersichtliche Gliederung (Tafel, Folie)
- mittleres Ausmaß an Kürze
- mittleres Ausmaß an Stimulans
- Übersichtsbemerkung, die den Zusammenhang mit vorangegangenem und nachfolgendem Unterricht herstellt
- klare Formulierung des Themas (Tafel, Folie Heft)
- Ergebnissicherung (Hefteintrag, Protokoll, Tafelbild, Zusammenfassung)
- angemessene Wortwahl
- Blickkontakt zur Klasse, freies Vortragen
- natürliche und naheliegende Form der Belehrung
- Lehrer kann mit seiner Sachkompetenz Überblicke und Zusammenhänge vermitteln
- Lehrer kann durch seine Wissensfülle das Thema lebendig und interessant darstellen und zum Nachdenken anregen
- Lehrer kann eine themengerechte Atmosphäre herstellen
- Lerninhalte sind klar formuliert und entsprechend abprüfbar
- geschichtliche Entwicklung des Computers
- Einführung / Überblick Datenschutz
- Themeneinstieg: Geschichte zur Motivation
- Bereitstellung von Fakten (z.B. Schleifenarten)
- Einführung, wecken der Neugier und Fragehaltung der Schüler
- Kontrolle und Bestätigung zuvor aufgestellter Hypothesen
- das Themengebiet nicht ohne vorherige Information logisch erschließbar ist.
- ein ganzheitlicher Eindruck angestrebt wird.
- ein zusammenhängender Gedankengang durchgeführt werden soll
- sich andere Unterrichtsformen wegen Zeitknappheit, großer Schülerzahl oder einfachem Thema nicht lohnen (Unterrichtsökonomie)
- sich die Schüler in einer Verfassung befinden, die aktive Beteiligung zurückdrängt (Atmosphäre, Schulungsstand, Arbeitshaltung, Müdigkeit, Entwicklungsstand).
- Programm mit Fehler
- Vorstellung von Teilen einer Programmiersprache
- Vorstellung einer eleganten Lösung (eines Schülers)
- Einführung in Tabellenkalkulation, Graphikprogramm, ...
- Lenkung durch den Lehrer
- Form der Leistungskontrolle, in der memoriertes Wissen gefragt wird
- entwickelt aus der mittelalterlichen Katechese
- Der Lehrer macht eine deutliche thematische Vorgabe
- Das Gespräch nimmt seinen Lauf
- Die Ergebnisse werden zusammengefaßt, gesichert und vertieft
- die Schüler ihre Vorkenntnisse einbringen können
- die Einstellungen, Meinungen und Interessen der Schüler eine Rolle spielen
- die Schüler auf das Gespräch vorbereitet sind und ihnen klar ist, in welchem Zusammenhang es steht und welche Funktion es hat, insb. was sie lernen sollen
- der Lehrer seine Fachkompetenz (durch Lehrervortrag oder Medieneinsatz) dort einbringt, wo die Schüler nicht weiterkommen
- Lehrer gibt den Inhalt (und letztlich auch das Ziel) des Gesprächs vor
- Lehrer zwingt die Schüler durch regelmäßige Zwischen- und Rückfragen zum aufmerksamen Nachvollziehen des Gedankengangs
- Erörterung umstrittener, konsensbedürftiger Fragen
- Rollenverteilung unter den Teilnehmern
- formale Regeln, die zu beachten sind
- Einübung demokratischer Formen
- Einübung von Konfliktlösungsmechanismen
- Gesprächsleiter (moderiert, achtet auf die Einhaltung von Regeln und Zeiten)
- Befürworter (vertritt und verteidigt eine Position)
- Gegner (vertritt und verteidigt eine Gegenposition)
- Beobachter (fungiert als Schiedsrichter oder Auswerter)
(Es kann natürlich auch mehr als zwei Meinungen zu einem Thema geben! Dann sind entsprechend mehr Rollen zu besetzen)
- Lehrer zieht sich möglichst weit zurück
- Schüler haben freien Raum, um ihre eigenen Erfahrungen, Bedürfnisse und Phantasien zu veröffentlichen und zu reflektieren.
- Lenkung durch den Lehrer
- Form der Leistungskontrolle, in der memoriertes Wissen gefragt wird
- entwickelt aus der mittelalterlichen Katechese
- Lehrer stellt die Aufgabe oder stimmt ihr zu
- Schüler arbeiten selbständig daran
- Schüler arbeiten für sich
- Forderung einer verbindlichen Leistung, für die der Schüler verantwortlich ist
- Selbständigkeit des Schülers
- Individualisierung nach Fähigkeit, Interessen, Arbeitstempo und Methode, nicht durch Verfügung über den Schüler, sondern durch dessen Einschätzung seiner Leistung
- eigenständige Beschäftigung des Schülers mit dem Thema
- Lerndiagnose
- Abwechslung zum direkten Unterricht
- Erfahrung aus erster Hand für den Lernenden
- größere Aufgabenstellungen, die arbeitsteilig zu lösen sind
- größere Aufgabenstellungen, deren Lösung einen längeren Zeitraum beansprucht
- fehlende Arbeitsmittel
- Nichtbeherrschen der Arbeits- oder Lerntechniken
- Verlängerung der Beschäftigung mit einem Thema durch Verlagerung nach Hause
- Schüler arbeiten für sich und nicht von Mitschülern gestört
- überwiegend thematische Orientierung
- überwiegend sprachliche Vermittlung
- Schüler sitzen und schauen zum Lehrer, an die Tafel, ins Heft oder ins Buch
- Kommunikation zwischen Schüler und Lehrer im Vordergrund, wobei der Sprechanteil des Lehrers meist größer ist als der aller Schüler zusammen
- Lehrer steuert die Arbeits-, Interaktions- und Kommunikationsprozesse
- alle Schüler sind in gleicher Weise am Unterrichtsgeschehen beteiligt
- sachliche Zusammenhänge, Probleme und Fragestellungen können aus der Sicht des Lehrers dargestellt werden à Schaffung einer allgemeinen Orientierungsgrundlage
- rationelle Unterrichtsform bei großen Klassen (zumindest aus Sicht des Lehrers)
- sozialisierende und disziplinierende Wirkung
- die Klasse kann als Gruppe anregend und fördernd wirken (Wetteifer, Zusammenarbeit, Gespräche, Gruppenprozesse)
- Verständnishilfe durch klare Strukturierung
- Lehrer hat bessere Übersicht und größere Einwirkungsmöglichkeiten
- Informationsfluß zu den Schülern verläuft schnell und einheitlich
- bei der Zusammenfassung und Sicherung von Ergebnissen
- bei der Einschulung von Arbeitstechniken
- zur Herstellung einer allgemeinen Orientierungsgrundlage
- zur Darstellung eines neuen Wissensgebiets
- bei der Überprüfung von Leistungsständen der Schüler
- in Phasen der Darbietung und gedanklichen Verarbeitung
- Teilung des Klassenverbandes in mehrere Kleingruppen, die gemeinsam an einem Thema arbeiten
- Zusammentragen der Gruppenergebnisse im Plenum
- arbeitsgleicher Gruppenunterricht: alle Gruppen arbeiten am gleichen Thema
- arbeitsteiliger Gruppenunterricht: die Gruppen arbeiten an verschiedenen Themen
- Moderation, Hilfestellung, Wissensvermittlung als Grundlage für die Arbeit
- Lehrer trägt nicht die volle Verantwortung für den Unterricht
- die Schüler können / müssen sich aktiv beteiligen und einbringen
- Förderung sozialer Fähigkeiten
- Ausbildung sog. Schlüsselfunktionen wie Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft, soziale Verantwortung
- Erziehung zur Selbständigkeit durch Selbsttätigkeit
- Lehrer kann Schüler in anderen Rollen beobachten
- Schüler können ihr Arbeitstempo und ihre Arbeitsmethode selbst bestimmen und ihre Interessen einbringen
- Mitglieder einer Gruppe ergänzen sich gegenseitig, so daß sie zusammen schwierigere Aufgaben besser meistern können als jeder einzeln
- Entstehung eines Zusammengehörigkeitsgefühls in der Gruppe
- solidarisches Handeln und Rücksicht auf andere werden geschult
- Schüler können sich ohne Scheu äußern und ins Unreine reden
- aufgrund der Selbsttätigkeit Identifikation mit dem Thema und daher intensivere Bearbeitung
- arbeitsgleich: alle Gruppen lösen das gleiche Problem; die Lösungen werden dann verglichen (hierzu bietet es sich an, mehrere Lösungen gleichzeitig an die Tafel schreiben zu lassen)
- arbeitsteilig: verschiedene Funktionen und Prozeduren werden auf verschiedene Gruppen aufgeteilt
- Verantwortlichkeit jedes Schülers für das eigene Lernen
- unmittelbare Zuwendung des Schülers zum Thema, Vertiefung
- "Festbeißen" (= Voraussetzung für Interesse und geistige Entwicklung ist)